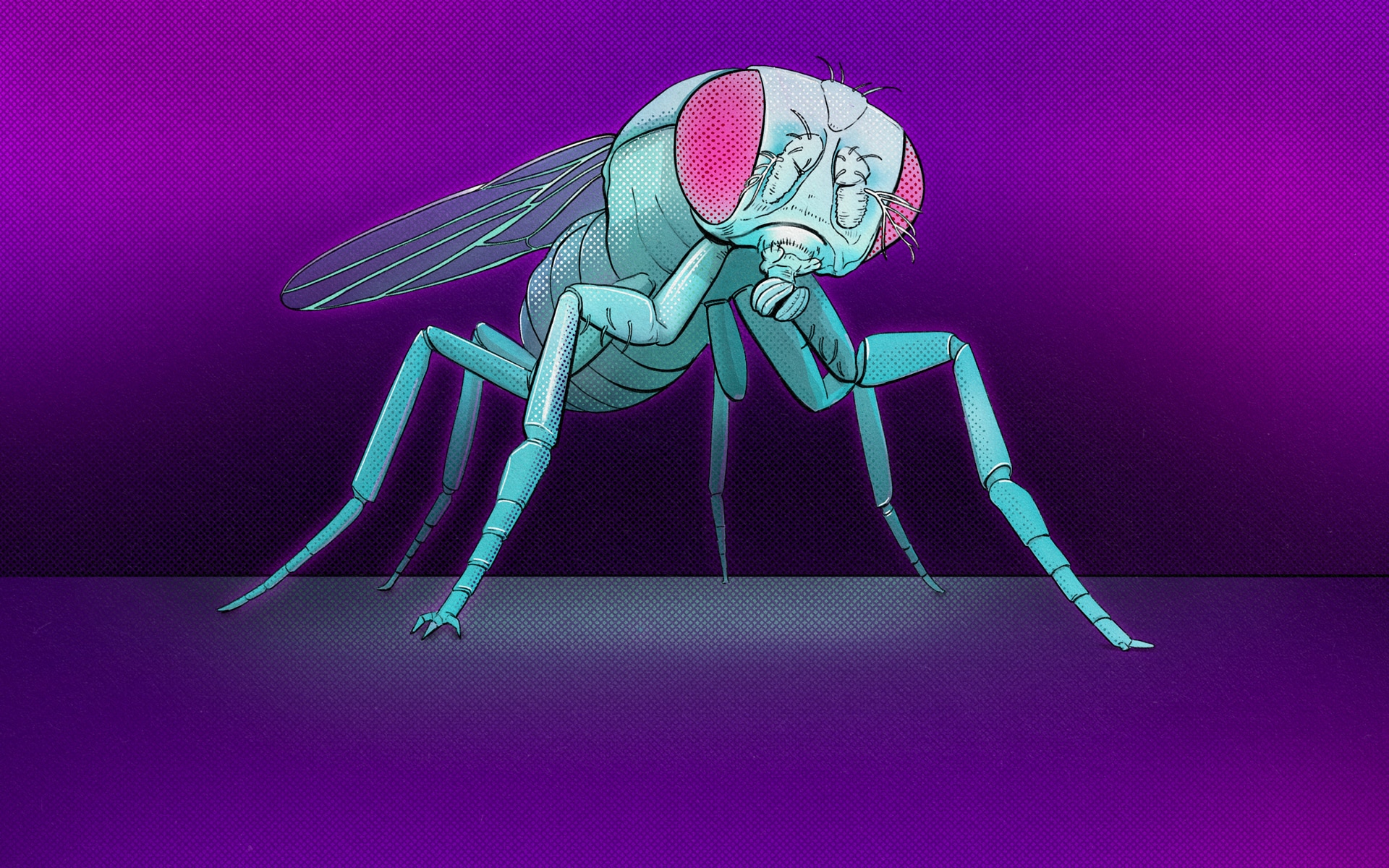Wenn digitale Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) auf den Alltag der Menschen treffen, wird es für Christoph Bareither interessant: „Mit meiner Forschung versuche ich herauszufinden, wie Menschen digitale Technologien nutzen, um ihren Alltag zu gestalten“, erzählt er, „aber auch, wie diese Technologien wiederum mit ihrer eigenen Wirkmacht den Alltag der Menschen prägen.“ Er betrachte beide Seiten gleichzeitig, um ein Grundwissen zu schaffen, das dabei helfe, unsere digitalen Gesellschaften besser zu verstehen.
Christoph Bareither ist Professor für Empirische Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt Digitale Anthropologie an der Universität Tübingen, Direktor des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft und Mitglied des Clusters „Maschinelles Lernen: Neue Perspektiven für die Wissenschaft“. Im Podcast „Key To My Research“ der Exzellenzstrategie der Universität Tübingen spricht er mit Moderatorin Jennifer Raffler über seine Forschung. Die Sprache des Podcasts ist Englisch.
Generative KI an der Uni: Mehr als nur Copy & Paste
Bareither beschäftigt sich unter anderem mit generativer KI und wie sie im akademischen Kontext genutzt wird. Für die Universität Tübingen untersucht er, wie Studierende und Forschende Programme wie ChatGPT nutzen und wie das ihre Art, Wissen zu schaffen und mit Wissen umzugehen, beeinflusst. Die Sorge, dass Hausarbeiten und auch Forschungsarbeiten nun weitgehend von Programmen wie ChatGPT geschrieben würden, ist weit verbreitet.
Doch in einer von Mitarbeiter Lukas Griessl durchgeführten Umfrage an der Universität Tübingen mit mehr als 500 Teilnehmenden und einer daran anschließenden ethnografischen Interviewstudie fanden Bareither und sein Team heraus, dass die Studierenden und Forschenden generative KI auch ganz anders nutzten. Etwa, um sich Konzepte oder Fachbegriffe erklären zu lassen, auf neue Ideen zu kommen oder um Schreibblockaden zu überwinden. Letztlich komme es immer darauf an, KI-Technologien nicht blind zu vertrauen und ihren Einsatz kritisch zu reflektieren, sagt Bareither. Hierzu möchte er mit seiner Forschung einen Beitrag leisten: „Wir versuchen, zu einer Zukunft beizutragen, in der wir bessere Entscheidungen darüber treffen, wie wir zusammen mit künstlicher Intelligenz leben können.“
KI verändert das Holocaust-Gedenken
Das Projekt „Von der Ära der Zeitzeugen zu digitaler Erinnerung“ (Originaltitel: „From the Era of Witness to Digital Remembrance”), an dem Bareither mit Forschenden der Ben-Gurion-Universität in Israel arbeitet, beleuchtet, wie verschiedene digitale Technologien die Kultur des Holocaust-Gedenkens verändern. Bareither und seine Doktorandin Berit Zimmerling beschäftigen sich mit KI-gestützten virtuellen Zeugnissen von Holocaust-Überlebenden. Die USC Shoah Foundation hat bereits seit 2015 mehrtägige Interviews mit Holocaust-Überlebenden geführt und auf Video aufgenommen. Mit diesem Material wurde ein KI-basiertes Sprachverarbeitungssystem gefüttert und trainiert. Die Idee: Auch in Zukunft, wenn die Zeitzeuginnen und -zeugen nicht mehr leben, sollen vor allem junge Menschen in Museen ihnen noch Fragen stellen und mit ihnen in einen emotionalen Dialog treten können. Möglich macht das das KI-System – denn es sucht die am besten passenden Antworten heraus und schafft so überhaupt erst die Voraussetzung für den Dialog. „Man muss dem KI-System also eine gewisse Handlungsfähigkeit zugestehen“, erklärt Bareither.
Aber was bedeutet das für Erinnerungskulturen? Bareither stellt klar, dass man hier nicht nach einem Schwarz-Weiß-Schema urteilen kann. Mit ihrer ethnografischen Forschung tauchen er und sein Team direkt in das Feld ein und beschreiben, was im Dialog zwischen den Menschen im Museum und den virtuellen Zeitzeugen passiert. So entstehen analytische Einblicke, erklärt er, die ihnen helfen würden, besser zu verstehen, was dort passiert. „Dieses Wissen könnte uns in Zukunft helfen, besser einzuschätzen, wie wir mit solchen Projekten umgehen wollen und welchen Einfluss sie auf Erinnerungskulturen haben.“
Textliche Zusammenfassung des Podcasts: Tran Trieu, Theresa Authaler
Hier findet ihr alle Folgen des Podcasts „Key To My Research“.
Projektleitung: Exzellenzstrategie – Universität Tübingen
Host: Jennifer Raffler
Produktion & Postproduktion: changing time Fotiadis & Veit GbR, Zentrum für Medienkompetenz (ZFM)

Bürgerrat „KI und Freiheit“: Menschen zum Mitreden ermutigen